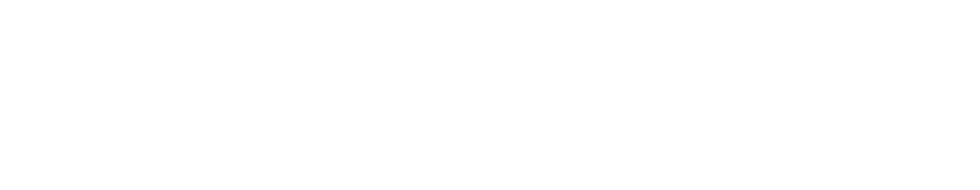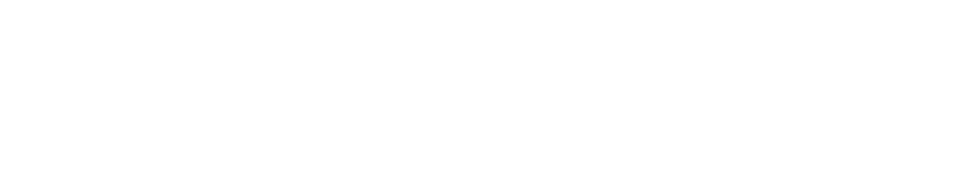12. Bonner Symposium zur Psychotherapie
„Jugend heute“ im Spagat zwischen Web 2.0. und Abi 1.0.
„Jugend“ – als Metapher für modern, offen, zukunftsorientiert, unverbraucht? Oder ein
Kultbegriff, der sich schnell verbraucht? Gibt es „den jugendlichen Alten“ genauso oft wie
den „ältlichen Jugendlichen“? Nehmen erst im Alter Intelligenz und Verständnis ... [mehr]
Kultbegriff, der sich schnell verbraucht? Gibt es „den jugendlichen Alten“ genauso oft wie
den „ältlichen Jugendlichen“? Nehmen erst im Alter Intelligenz und Verständnis ... [mehr]
Was ist eigentlich neu an den „Neuen Medien“?45 min, deutschInhalt / abstract  Seit gut 20 Jahren befinden wir uns im Zeitalter der „digitalen Revolution“: Kommunikationsweisen haben sich radikal verändert. Internet, PCs und Handys sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, entwickeln sich in atemberaubendem Tempo weiter, verschmelzen miteinander... Die Gesetze von Raum und Zeit scheinen aufgelöst. Menschen bewegen sich weltweit und in Echtzeit in sozialen Netzwerken und stürzen dabei ganze Regierungen… Gleichzeitig warnen Pädagogen und Psychologen vor den Gefahren ungebremsten Medienkonsums, machen Computerspiele für das Entstehen psychischer Störungen verantwortlich oder gar als Ursache für Amokläufe… Gegenstand des Vortrags ist der Versuch einer unaufgeregten Betrachtung und Einordnung neuer (und alter) Medien in unsere Lebenswelt(en) im Allgemeinen und in die der Kinder und Jugendlichen im Besonderen. | ||
|
Selbstmanagement-Therapie mit Jugendlichen – die Rolle der psychischen Grundbedürfnisse45 min, deutschInhalt / abstract  Die Psychotherapie mit Jugendlichen lebt in jeder Phase des therapeutischen Prozesses davon, dass auf die besonderen Entwicklungsaufgaben und Befindlichkeiten der Jugendlichen eingegangen wird. Von besonders großer Bedeutung für eine gelingende Psychotherapie ist, dass die psychischen Grundbedürfnisse (Bindung, Orientierung/Kontrolle, Selbstwert, Lustgewinn) der PatientInnen in den Fokus gerückt werden. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, jede Phase der Therapie (Beziehungsaufbau, Motivationsaufbau, Diagnostik, Zielklärung, Intervention, Evaluation, Abschluss) so zu gestalten, dass die Grundbedürfnisse der Jugendlichen befriedigt werden. | ||
|
„Ob man denen vertrauen kann… ?“ Traumatisierte und sozial benachteiligte Jugendliche verstehen und erreichen…45 min, deutschInhalt / abstract  Folgen wir den Daten der KIGGS-Studie, geht es manchen Kindern und Jugendlichen heute deutlich besser als noch vor Jahren und Jahrzehnten. Lediglich 8,1% der Kinder aus Familien mit hohem Sozialstatus zeigen Merkmale psychischer Auffälligkeiten. Ganz anders gestaltet sich dieses Verhältnis für Familien mit niedrigem Sozialstatus: dort beträgt der Anteil 23,2%, also ein knappes Viertel der befragten Kinder und Jugendlichen. Ein hoher Anteil der psychischen Auffälligkeiten beinhaltet traumatische Belastungen. Traumatisierte Jugendliche aus diesem sogenannten „Multiproblembereich“ benötigen daher dringend professionelle Unterstützung, können diese aber häufig aufgrund schwer erschütterter Bindungsrepräsentationen nicht oder nur sehr schwer in Anspruch nehmen. In meiner Praxis der Psychotherapie und Beratung machte ich immer wieder die Erfahrung, wie stark der Hilfeerfolg von einer gelungenen Gratwanderung bzgl. dieses Dilemmas abhängt. Im Rahmen mehrerer Forschungsprojekte wurde die Fragestellung auf einer wissenschaftlichen Basis vertieft. Der Vortrag soll den Schwerpunkt auf eine als zentral erfahrene Schlüsselqualität legen: auf die behutsame Gestaltung der Hilfebeziehung als Antwort auf vielfach erfahrenen Vertrauensmissbrauch. | ||
|
Genderaspekte in der Behandlung von suchtmittelabhängigen jungen Erwachsenen (zwischen 18 und 27 Jahren)45 min, deutschInhalt / abstract  Die Entwicklungsthemen bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 27 Jahren zeigen geschlechtsdifferente Ausgestaltungen und Bewältigungsformen. Zu den vorherrschenden Problemlösungsstrategien zählt auch der zunehmend abhängige Substanzkonsum. Die Behandlung suchtmittelabhängiger junger erwachsener Menschen muss Anforderungen berücksichtigen, die sich aus den geschlechtsspezifischen Unterschieden bei den Entwicklungsaufgaben für den bezeichneten Lebensabschnitt und in Bezug auf die Suchtmittelabhängigkeit ergeben. Grundlegende gesicherte Daten und Analysen existieren allerdings kaum. Im Vortrag werden Erfahrungen aus der stationären Therapie von drogenabhängigen Frauen und Männern einer Fachklinik mit einer Spezialisierung für die Therapie junger Erwachsener und die geschlechtsgerechte Behandlung beispielhaft vermittelt. | ||
|
Ein polyästhetischer Ansatz zur Integration von Bewegung und Musik in den Lernalltag von Kindern und Jugendlichen45 min, deutschInhalt / abstract  Kinder und Jugendliche sind oftmals großer Bewegungsarmut ausgesetzt. Sie sitzen einen Großteil des Tages in der Schule, stehen auf dem Schulhof und sitzen nachmittags bis abends meist vor dem Computer und „surfen“ im Internet. Dabei arbeiten die Hände feinmotorisch auf Hochleistung, nicht aber der ganze Körper. Das Gehirn arbeitet einseitig, und viele körperliche Möglichkeiten werden nicht genutzt und können verkümmern. Die essentielle Kraft von Bewegung ist in unserer Gesellschaft in Vergessenheit geraten, bzw. findet immer mehr isoliert im Vakuum von Fitnessstudios statt. Dabei kommen ästhetische Erfahrung und Bewegung bzw. der Mensch in seiner Ganzheit zu kurz. Das Isolieren menschlicher Bestandteile führt zu einer inneren Entfremdung. „con Takt!“ ist ein Konzept, bei dem der ursprüngliche Bewegungs- und Äußerungsdrang sowie die Neugier nach ästhetischer Erfahrung aufgegriffen werden und Lerninhalte miteinander durch Musik und Bewegung gekoppelt werden. Dabei geht es um den Wechsel zwischen Aktion und Stille, in der das ganz-körperliche Wahrnehmen und Inne- halten im Vordergrund stehen. Bewegung ist uns Menschen ureigen, von der Entstehung an. Darüber hinaus ist Bewegung eng mit Rhythmus, Sprache und Musik verbunden. Ziel von „con Takt!“ ist es, durch Bewegung und Musik mit sich selbst in einen bewussteren Kontakt zu kommen. Besteht Kontakt zu sich selbst, ist auch der Kontakt zum Gegenüber möglich, ein wichtiger sozialer Aspekt. Kontakt zu sich eröffnet die Wahrnehmung persönlicher Ressourcen und unterstützt kognitive und kreativ-gestalterische Aspekte – sowohl für das Individuum selbst, als auch in der Gruppe. | ||
|
Von der (Un-)Möglichkeit erwachsen zu werden – mit aktuellen Bezügen zur Ausstellung60 min, deutschInhalt / abstract  Das Jugendalter ist einerseits deutlich riskanter geworden und andererseits aus dem fachlichen und gesellschaftlichen Blickfeld geraten. Die zunehmenden psychosozialen Probleme Heranwachsender, die durch aktuelle Studien aufgezeigt werden, erfordern eine Fokussierung auf das Jugendalter. Jugendspezifische Erfahrungswelten werden in einer Gesellschaft erheblich komplexer und risikoreicher, in der zunehmend einheitliche Ziele und Werte abhanden kommen, die von der Pluralisierung der Lebensstile gekennzeichnet ist und in der die gegebenen Lebenschancen höchst unterschiedlich verteilt sind. Der tief greifende soziokulturelle Umbruch, der sich gegenwärtig vollzieht, zeigt gerade bei Heranwachsenden seine "Kostenseite". Die Lebenssituation von Jugendlichen ist heute durch eine eigentümliche Spannung gekennzeichnet: Einerseits sind auch schon für Jugendliche die Freiheitsgrade für die Gestaltung der eigenen individuellen Lebensweise sehr hoch. Andererseits werden aber diese "Individualisierungschancen" erkauft durch die Lockerung von sozialen und kulturellen Bindungen. Der Weg in die moderne Gesellschaft ist, so gesehen, auch ein Weg in eine zunehmende soziale und kulturelle Ungewissheit, in moralische und wertemäßige Widersprüchlichkeit und in eine erhebliche Zukunftsunsicherheit. Deswegen bringen die heutigen Lebensbedingungen auch so viele neue Formen von Belastung mit sich, Risiken des Leidens, des Unbehagens und der Unruhe, die teilweise die Bewältigungskapazität von Jugendlichen überfordern. Sie zahlen, um im Bild zu sprechen, einen "hohen Preis" für die fortgeschrittene Industrialisierung und Urbanisierung, der sich in körperlichen, psychischen und sozialen Belastungen ausdrückt. | ||
|
Gibt es die „Jugendliche Identität“? – Psychotherapie zwischen Adoleszenzkrise und Identitätsdiffusion45 min, deutschInhalt / abstract  Diese Frage spielt für die Psychotherapie von „schwierigen“ Jugendlichen mit dem Verdacht des Vorliegens einer Persönlichkeitsstörung eine zentrale Rolle. Denn nach den jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen kommt bei der Unterscheidung zwischen Persönlichkeitsstörung und Adoleszenzkrise der Frage des Vorliegens einer Identitätsstörung oder –diffusion eine wesentliche Bedeutung zu. Im Rahmen der Ausarbeitung des DSM-V wird diskutiert, dass insbesondere zwei Faktoren als einheitliche Grundlage für das Vorliegen von Persönlichkeitspathologie anzusehen sind: die Störung der Identität oder Selbstdefinition und die Unreife in der Ausgestaltung von Beziehungen. Lange Zeit wurde jede Kontinuität zwischen Jugend- und Erwachsenenalter für die Frage der Persönlichkeitsdiagnostik mit der Begründung angezweifelt, dass Jugendliche noch keine vollständig ausgebildete Identität besitzen und deshalb bei ihnen nicht von Persönlichkeitspathologie gesprochen werden kann. Diese Festlegung entsprach nicht unbedingt der klinischen Erfahrung derjenigen, die mit schwierigen Jugendlichen psychotherapeutisch zu tun hatten. Nach den letzten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Behandelbarkeit und der hohen Spontanremissionsrate von Persönlichkeitsstörungen im Erwachsenenalter ist für das DSM-V ein Umdenken geplant mit Ausdehnung der Altersgrenzen und einem einheitlicheren Konzept von Persönlichkeitspathologie, das an die Idee der „frühen Störung“ erinnert. In der klinischen Realität nimmt das Interesse an spezialisierten Psychotherapieansätzen zur Behandlung von Jugendlichen mit „Persönlichkeitsstörungen“ zu. In diesem Vortrag sollen die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Frage des Vorliegens einer Identitätsstörung bei Jugendlichen und praktische Erfahrungen in der tiefenpsychologisch fundierten psychotherapeutischen Behandlung von Jugendlichen mit und ohne Identitätsdiffusion vorgestellt werden. | ||
|
Familienbilder im Wandel – jugendliche Mütter im Visier45 min, deutschInhalt / abstract  Wenn schon kleinste Kinder Vernachlässigung, emotionale Überflutung oder Missbrauch erleben, fehlt ihnen die Basis für die Entwicklung einer „gesunden“ psychischen Perspektive. Diese Kinder, wenn sie Mädchen sind, werden häufig selbst als Jugendliche schon Mütter. Sie binden ihr Baby an sich in der Hoffnung, endlich „eine gute Beziehung“ zu haben. Der Vortrag problematisiert an Beispielen aus der eigenen psychotherapeutischen Praxis das Phänomen der „jugendlichen Mutterschaftskonstellation“ in einer Gesellschaft, in der sich die „bürgerliche Kernfamilie“ aufgelöst hat, das Bedürfnis in der Jugend nach tragfähigen Bindungen und Beziehungen jedoch weiterhin vorhanden ist. An klinischen Fallvignetten werden Konzept-Leitlinien für eine auf die Identitätsprobleme jugendlicher Mütter fokussierende Eltern-Säuglings- Kleinkind-Psychotherapie dargestellt. Trautmann-Voigt S. u. Moll M. (2011): Bindung in Bewegung - Konzept und Leitlinien für eine psychodynamisch fundierte Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie. Gießen: Psychosozial. | ||
|
Partizipation Jugendlicher in Deutschland – Vom Objekt der Beobachtung zum Subjekt der Zukunft45 min, deutschInhalt / abstract  Bei der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für ein kindergerechtes Deutschland 2005–2010 bemühte man sich Ende 2005 Anfang 2006 kurz um die Meinung von Kindern und Jugendlichen bei der weiteren Entwicklung dieses Plans. Ein Bewusstsein für eine nachhaltige Beteiligung von Kindern und Jugendlichen z.B. in den Kommunen und in den Schulen entwickelt sich aber nur mühsam. Im Bereich der Gesundheitsfürsorge, sowohl bei körperlichen, aber auch bei psychischen Problemen von Kindern und Jugendlichen ist das Problem der Beteiligung der betroffenen Kinder und Jugendlichen wenig entwickelt. Jüngste sog. „Erziehungsratgeber“ spiegeln die Selbstgefälligkeit Erwachsener im Umgang mit Kindern und Jugendlichen wider. Die im Kinder- und Jugendhilfegesetz festgeschriebene Beteiligung der Betroffenen wird nicht durchgängig gelebt. Kinder und Jugendliche erwarten immer noch weniger Beteiligung als ein Klima elterlicher Vorschriften, denen sie sich zu beugen haben oder gegen die sie protestieren können, obwohl im BGB Eltern vorgeschrieben wird, ihre Kinder an ihren Erziehungsmaßnahmen zu beteiligen. Kinder und Jugendliche tun dies, was sie immer getan haben, sie flüchten in Parallelwelten, weil die Beteiligung am echten Leben frustrierend und undemokratisch bis despotisch gestaltet ist. Gerade bei der Überwindung psychischer Probleme brauchen die jungen Mitbürger jedoch eine Ermutigung zur Subjektivität. Die Hoffnung jeder Gesellschaft liegt in der Fähigkeit der Nachkommen zur Eigenständigkeit und zur Erfindung neuer Antworten auf die noch nicht bekannten Fragen der Zukunft. Nicht selten sind die heute psychisch gestörten Kinder die Protagonisten neuer Anpassungsleistungen, deren Bedeutsamkeit sich langsam entfaltet. | ||
|
Bewältigungsmuster in der Lebensvielfalt - wie lässt sich die Resilienz von Jugendlichen stärken?45 min, deutschInhalt / abstract  Angesichts der "Multioptionalität" der Lebensbedingungen stellen sich die Entwicklungsaufgaben des Jugendalters neu: Es geht weniger um das Abgrenzen von Vorgegebenem, sondern um die Fähigkeit, auszuwählen, das eigene Leben immer wieder neu zu "basteln". Hierzu wählen Jugendliche gelingende oder dysfunktionale, oft schmerzhafte Bewältigungsformen. Der Vortrag zeigt Möglichkeiten auf, Jugendliche auf die Bewältigung von Lebensvielfalt vorzubereiten und zu unterstützen, insbesondere geht es um die Stärkung der Lebenskompetenzen und der Resilienz. Dabei wird nicht nur eine psychotherapeutische, sondern auch eine präventive Perspektive eingenommen. | ||
|
„So jung und schon Kinder- und Jugendlichen- psychotherapeut?“45 min, deutschInhalt / abstract  In der aktuellen berufspolitischen Debatte um die Zukunft unseres Heilberufes stoßen wir auf die Vorstellung in der Ministerialbürokratie, die gerne eine Ausbildungsstruktur analog der medizinischen oder pharmazeutischen Ausbildung sähe und wenig Verständnis für die besonderen Erfordernisse des psychotherapeutischen Berufs aufbringt. Man solle Psychotherapie studieren können wie eben Medizin. Was würde das für den psychotherapeutischen Beruf, für die Kompetenz als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut bedeuten, wenn Jugendliche direkt nach dem Abitur (nach 12 Schuljahren) Psychotherapie studieren würden? Ist das eine Perspektive, die wir als Profession mitgehen wollen? Gibt es hierbei verfahrensspezifische Unterschiede in der Bewertung dieser Frage? | ||
|
Zwischen Medienkompetenz und Medienabhängigkeit - psychodynamische Erkundungen45 min, deutschInhalt / abstract  Die spezifische intraindividuelle und familiäre Psychodynamik von adoleszenten Medienabhängigen wurde bisher eher an Kasuistiken erarbeitet. Wenige Befunde aus Spezialsettings in Asien weisen auf intensive familiäre Verstrickungen hin. Während bei leichten Fällen Psychoedukation und erzieherische Maßnahmen ausreichen, um bessere soziale Adaptation zu erreichen, sind hochgradig beeinträchtigte Patienten nur durch aufwändige stationäre Maßnahmen zu erreichen, die in der Therapieplanung neben den allgemeinen psycho-sozialen Interventionen auch die Pharmakotherapie und die individuelle Psychodynamik berücksichtigen müssen. Neben den schulischen und sozialen Ausfällen zeigten sich bei stationären Patienten erhebliche strukturelle Defizite in der Emotionsregulation, eng verstrickte Beziehungen zu den leiblichen Müttern und überzufällig häufige Versorgungs-Autarkie-Konflikte sowie eher unreife Abwehrmechanismen. Konfliktmuster und seelische Strukturniveaus sind für die langfristige Interventionsplanung bei Adoleszenten mit schwerwiegendem Medienmissbrauch von hoher Bedeutung. Ein früher Fokus der Beratung auf im Hintergrund wirksame Konflikte kann auch die Akzeptanz von familienorientierten Interventionen erhöhen. Diese klinisch-therapeutischen Überlegungen stehen im Gegensatz zu epidemiologischen Befunden, die die Ressourcen der neuen Medien in den Vordergrund stellen oder rein suchtmedizinischen Ansätzen, die im Kindes- und Jugendalter latent und manifest wirksame Konfliktdynamiken vernachlässigen. Genaue Kenntnis der gängigen Spiele im Sinne eines adaptierten szenischen Verstehens ist für den Therapeuten wie für den Klienten Voraussetzung gelingender Kooperation. | ||
|